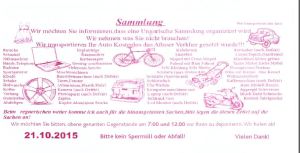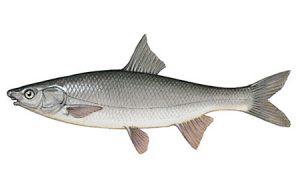Bausteleimaschine (auch defekt)
„Wir transportieren Ihr Auto Kostenlos das Aßuser Verkher gesetzt wurde!!!“, stand auf dem windigen Zettel im Briefkasten meiner Großmutter. Und was da noch alles für die „Ungarische Sammlung organisiert am 21. Oktober“ benötigt wurde: Implattfelgen, Rasenmäher, Kettensagen, Gestrüp scnittmeister, electronic und benzin, Mischmaschinen.
Meine Großmutter war ratlos. Kettensagen? Wir kannten ja Heldensagen und Göttersagen, auch Ortssagen sind dem Sagenkundigen durchaus bekannt. Aber Kettensagen? Sollten das diese so genannten Urban Legends sein, die durch das Internet geistern und immer weiter verschickt werden? Wir studierten den kleinen Zettel mit seinen verschwommenen rosa Buchstaben weiter. Auch eine Waduhr wurde gesucht. Was war das nun schon wieder? Vielleicht ein wasserdichter Zeitmesser, mit dem man im Watt waten kann? Vorsichtshalber schaute ich im Keller nach, fand aber nur eine Wasseruhr, und die wollten die ungarischen Sammler ja nicht. Wir studierten die Liste weiter: Gesucht wird eine „Bausteleimaschine (auch defekt), sowie einen „Ofen mit Kamin“.
„Ofen, ist das nicht eine Stadt in Ungarn?“, fragte meine Großmutter, „und die haben da keine Kamine? Enkelchen“, befahl sie kurz entschlossen, „wir helfen diesen armen Menschen!“ Da klingelte es auch schon.
Ein Mann mit rotem Hütchen, Pelzweste und Rauschebart hatte nicht nur einen scrottreifen (auch defekt) Transporter in den Hof gestellt, sondern auch gleich den Fuß in die Tür. Bevor ich etwas sagen konnte, sprudelte er auch schon los: „Haben Du Led Monitor?“ Ich war etwas unschlüssig und brachte ihm eine Platte von Led Zeppelin an die Tür: „Da schauen, Sie Led!“ „Du bled“, sagte er, „ich brauchen keine Platte, ich brauche Kleide, Schuhe, Bedwasche!“ Er redete sich in Rage. „Bed, nicht Led, du verstehen?“ Wütend drückte er sich unter meinem Arm durch, fegte durch den Flur und verschwand im Wohnzimmer.
„Bruch Gold Schmucke, Photoaparat (auch defekt)!“, hörte ich es eine Zeitlang zwischen den Polstergarnituren und der altdeutschen Schrankwand meiner Großmutter bellen. Offensichtlich hatte er nichts Passendes für die ungarische Sammlung gefunden, denn nach wenigen Minuten öffnete sich die Wohnzimmertür einen Spalt und der Kopf des ungarischen Sammlers ragte hervor. „Wo ist Kompressor, Sterimo? Und ein Kolter, du haben Kolter?“ Wie gut, dass ich immer meinen Impfpass in der Tasche trug: „Nein, ich habe kein Kolter.“ Da verlegte er sich aufs Betteln: „Aber Briederchen, etwas du doch geben für arme Mann aus Pußta-Wald. Ich nehmen auch Zapfen, Kupfer, Aluminium Stücke.“ Der gute Mann dauerte mich. Ich schenkte ihm meinen Restvorrat an Ostmark, und er zog ab.
Seit der Zeit kommt er alle drei Wochen wieder, und ich gestehe es, meine Großmutter und ich wir freuen uns herzlich darüber.
Neulich zeigte ich ihm die elektrische Kaffeemühle von Onkel Fritz und erklärte ihm: „Kompressor, Sterimo schön laut!“ Er lachte verzückt. Die alte elektrische Dauerwellenbrennschere von Tante Berthild bezeichnete ich rücksichtslos als Fotoapparat. Erst wollte er sie nicht annehmen und wir diskutierten, bis ich die erlösenden Worte fand: „Photoaparat (auch defekt)“, worauf er das Gerät beglückt einsteckte. Es gehört so wenig dazu, einen armen Mann aus fremdem Land fröhlich zu machen. Glück und Freude zu schenken, das ist es doch, was unser Leben sinnvoll und reich macht.
Nur einmal zweifelte ich daran, dass diese ungarische Sammlung überhaupt stattfindet. Denn es gibt einen starken Hinweis darauf, dass er den „Photoaparat (auch defekt)“ gar nicht nach Budapest gefahren, sondern für sich behalten hat. Als er an einem regnerischen Tag im Spätherbst klingelte, standen ihm die Haare zu Berge, und sie rochen leicht verbrannt. Aber vielleicht hat er die Haare auch nur in den Kamin gebracht. Die haben sie ja jetzt sicherlich in Ofen.